



Affekte könnnen wir leicht benennen: Wenn uns die Hutschnur hochgeht, spüren wir unsere Wut. Wir wissen zumindest für uns selbst, dass wir wütend sind. Unerwünschte Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, ist schon schwieriger: In der engen Freundschaft möchte ich meinen Neid nicht spüren, doch ich kann lernen, ihn nicht gleich wegzuschieben. Trauer, Wut, Neid, Ekel, Angst und Freude sind Emotionen und Affekte, die wir oft leicht benennen können. Doch was sagst Du, wenn Du gefragt wirst: Was fühlst Du jetzt? Wie sollst Du beschreiben, was eigentlich ist, wenn „es“ wieder da ist, wenn Du Gefühle hast, die keinen Namen haben?
Oft leben wir einfach vor uns hin, doch zwischendurch nehmen wir sozusagen eine „Innenmessung“ vor (Danke an Walter von Lucadou, Parapsychological Association, für die Inspiration). Manchmal können wir sagen, was wir gerade fühlen, sehr oft aber auch nicht. So, wie die Inuits wohl sehr viele Worte für die vielen Arten von Schnee haben, so müssten wir eigentlich auch sehr viele Worte für die vielen Arten von Gefühlen in uns haben. Haben wir aber nicht.
„Ich fühle mich so tzzzzz!“, sage ich manchmal, wenn ich ganz merkwürdig angespannt bin. Diesen Ausdruck verdanke ich einem guten Freund im Studium, der mich vor einem Anatomiekurs einmal so beschrieb – dabei gestikulierte er so mit den Händen, als liefe Strom dort hindurch. Ich fühlte mich sehr gut verstanden – gleichzeitig beunruhigt ich es mich, dass ich trotz psychoanalytischer Ausbildung oft nicht anders kann, als zu sagen: „Ich fühle mich so tzzzz!“ Immer wieder legte ich mir das als eine Art Schwäche oder Gefühlsblindheit aus. Erst nach vielen Jahren konnte ich sagen: Das ist normal.
Wir haben nicht nur klassische, benennbare Gefühle, sondern auch Körper- und Seelenzustände, für die es keine Worte gibt. Natürlich wissen wir das – wir wissen, dass wir das Wortlose in der Kunst, in der Musik, in der Poesie finden. Und doch zweifeln wir vielleicht manchmal an uns selbst, wenn wir „schon wieder“ nicht sagen können, was wir eigentlich fühlen. Vielleicht hilft es, sich zu verdeutlichen, dass Gefühle immer auch mit Körperzuständen verbunden sind. Und diese können wir oft nur durch Bildbeschreibungen oder Laute verdeutlichen.
Wenn wir beschreiben wollen, wie sich eine volle Blase, ein Orgasmus oder eine Übelkeit anfühlen, dann können wir das eigentlich nur in Bildern tun: Es ist, als ob sich ein See zwischen Mauern ausbreitet, wenn unsere Blase voll ist. Es drûckt. Und so lassen sich auch unsere Traumbilder verstehen: Die Bilder drücken aus, wozu uns die Worte fehlen. Und wenn Du Dir das nächste Mal damit Druck machst, dass Du doch eigentlich sagen können müsstest, was Du fühlst, dann kannst Du Dich vielleicht damit beruhigen, dass das Nicht-Benennenkönnen eben allzu oft auch ganz normal ist.
Thomas Fuchs (2013):
Phänomenologie der Stimmungen
In book: Stimmung und Methode (2013, pp.17-31)
Mohr Siebeck, Tübingen
https://www.researchgate.net/publication/292964531_Phanomenologie_der_Stimmungen
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 15. November 2024
Aktualisiert am 8.1.2025
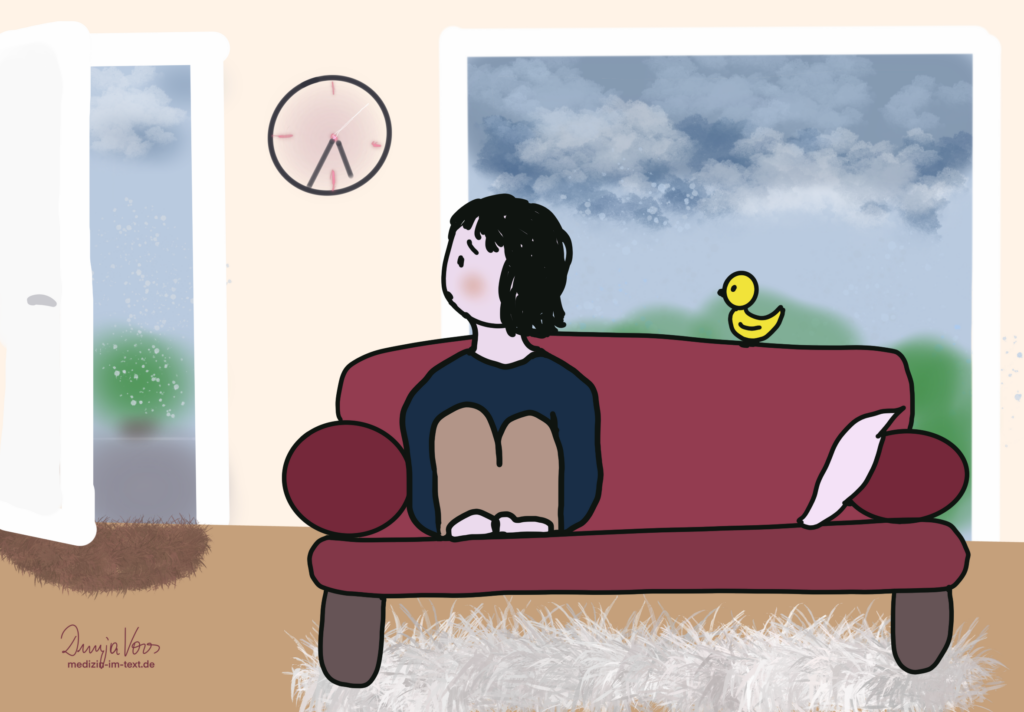
Heute muss sogar das Trauern schnell gehen – wir haben sonst Angst, wir könnten an einer „pathologischen Trauer“ oder gar Depression leiden. Alte Texte können da sehr hilfreich sein, zum Beispiel vom Schriftsteller Victor Hugo (1802-1885), der viel Leid erfuhr (übersetzt von Voos): „Nach dem Ertrinken seiner Tochter Léopoldine im Alter von 19 Jahren am 4. September 1843, publizierte Victor Hugo zehn Jahre lang nichts. Er wartete drei Jahre, bis er den Text ‚Einige Verse für meine Tochter‘ schreiben konnte (veröffentlicht im 4. Buch der „Kontemplationen“ von 1856). Youtube: Alain Deneux – De la souffrance de la perte à la construction de soi).Weiterlesen

Wir können vor Wut heulen oder tief-traurig schluchzen. Wir können leise in uns hieinweinen oder vor Angst wimmern. Sind wir überwältigt von Freude oder Schmerz, können uns ebenfalls die Tränen kommen. Je nach Art des Weinens reagiert auch unser Gegenüber: verunsichert, selbst traurig und tröstend, mitfühlend, schweigend oder genervt. Patholgisches Weinen bei schweren psychischen oder hirnorganischen Störungen erkennen wir in der Regel rasch – es ist mitunter monoton, unpassend und irritierend. Weinen vor Trauer setzt voraus, dass wir uns selbst als eigenständiges Wesen begreifen und Trennung erleben können. Wir weinen, wenn wir etwas oder jemanden verlieren. Mütter stellen manchmal einen Zeitpunkt fest, an dem das Schreien des Babys in ein Weinen aus Trauer übergeht.Weiterlesen
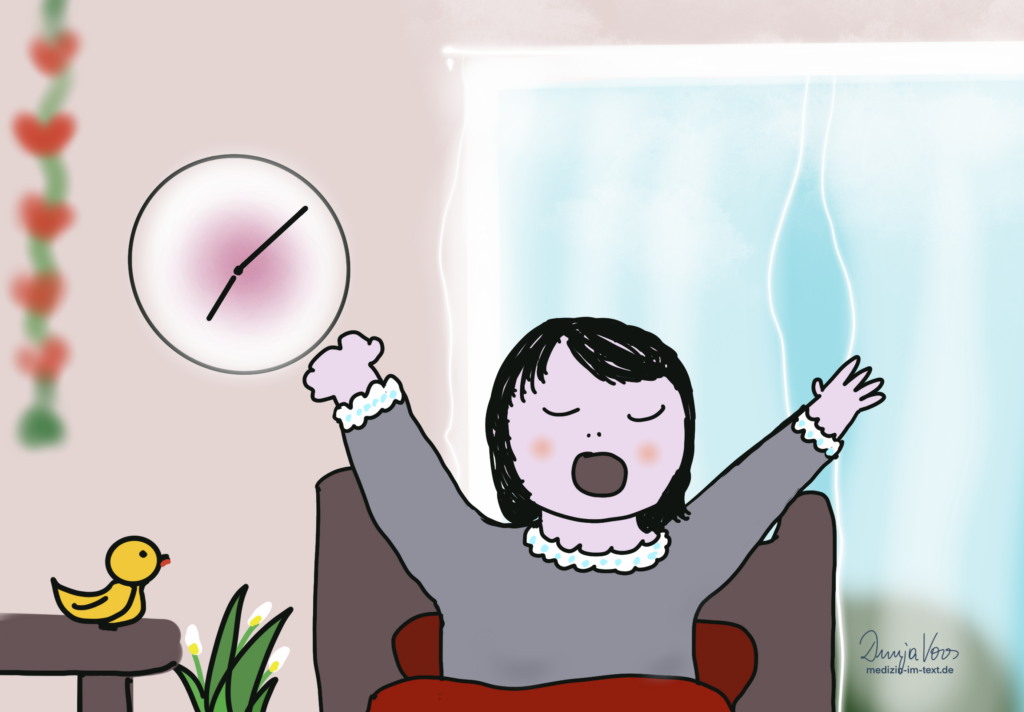
Bei vielen Menschen wechselt die Durchlässigkeit der Nasenlöcher spürbar etwa alle 90 Minuten (Atanasov & Dimov, 2003): Einmal ist das linke Nasenloch freier, dann das rechte. Nach ayurvedischer Medizin gehört das rechte Nasenloch zum sympathischen und das linke zum parasympathischen Nervensystem. Ist das rechte Nasenloch frei, sind wir mitunter aktiver und fühlen uns wacher. Wird das linke Nasenloch wieder freier, kommen wir oft in einen Ruhezustand. Weiterlesen

Wenn wir uns nachts wälzen, wenn wir grübeln und uns sorgen, kann es gut tun, den Ort der Qual zu verlassen. Wenn wir uns auf eine Decke auf den harten Boden legen, kann das Gefühl einer Sicherheit entstehen: Hier kann ich nicht mehr fallen. Ich habe den direkten Kontakt zum Boden. Die Härte des Bodens kann eine Art „Selbststrafe“ sein, die wir manchmal suchen, aber manchmal vielleicht auch wie eine Art Trost. Wenn wir uns auf den Boden ans leicht geöffnete Fenster legen, spüren wir, wie die frische Luft über unser Gesicht streicht. Auf dem Boden zu liegen, kann Ängste reduzieren. Durch das körperliche Erleben der relativen Härte kann sich das Ich-Gefühl wieder stärken. Weiterlesen

„Ich wache nachts öfter auf, bekomme Herzrasen und dann eine furchtbare Panikattacke.“ Viele Menschen mit Angststörungen kennen plötzliche Panikattacken in der Nacht. Es gibt viele Erklärungen: zu schwere Kost am Abend, vorbewusste Gedanken im Halbschlaf, beängstigende Träume, sexuelle Konflikte, körperliche Ursachen wie Schilddrüsenfunktion, Medikamente oder Unterzuckerung werden häufig genannt. Doch was kaum berücksichtigt wird ist die Frage nach der Körperhaltung. Weiterlesen
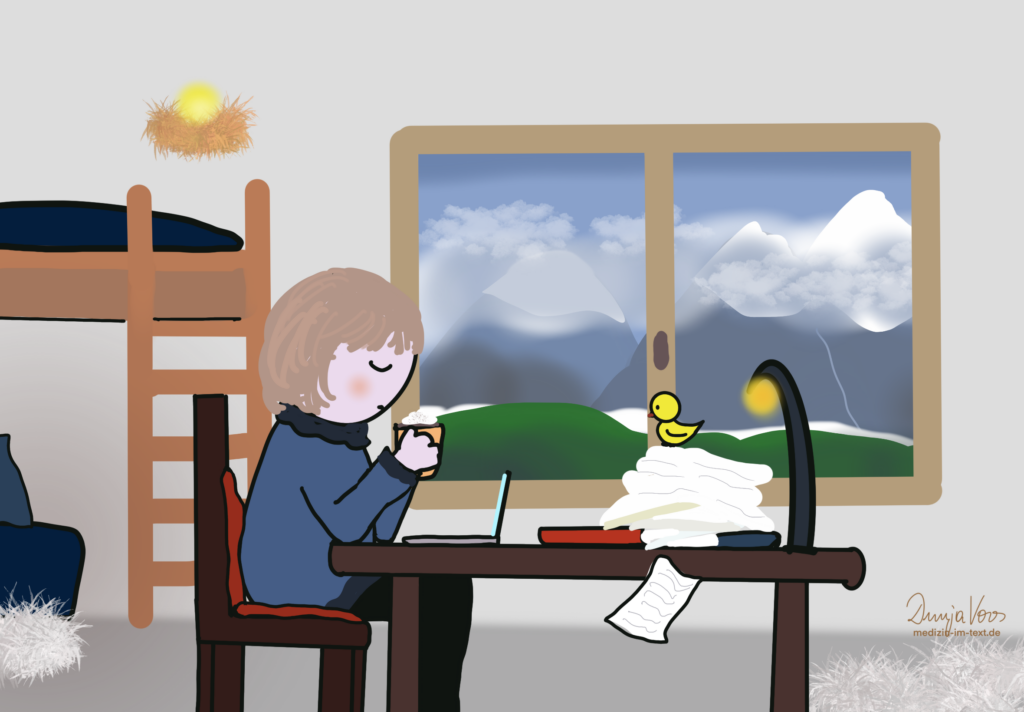
„Wenn Du weißt, was Du willst, kannst Du Berge versetzen“, heißt es. Manche haben die Erfahrung gemacht, dass sie nahezu Übermenschliches schaffen, wenn der Wille und die Not gross sind. Wer Schaffenskraft, Energie, vielleicht auch Wut und Mut hat, der kann unglaublich viel verändern. Doch wird die Veränderung am Ende nicht immer als Gewinn empfunden. Es gibt Situationen im Leben, da ist es besser, den Berg stehen zu lassen, wo er ist. Es zu unterlassen, den Berg zu versetzen, kann um ein Vielfaches mehr Kraft kosten, als Berge in Bewegung zu setzen.Weiterlesen
Wer früh traumatisiert wurde, der hat lebenslange Fehlregulationen in der HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse), sagen Stressforscher und Entwicklungspsychologen häufig (z.B. Gunnar und Quevedo, 2007). „Sowie eine Gefahr erkannt wird, bildet der Hypothalamus vermehrt den Corticotropin-Releasing-Factor (CRF), der die Hypophyse zur Ausschüttung von Corticotropin veranlasst; dieses heißt auch adrenocorticotropes Hormon, kurz ACTH, weil es die Nebennierenrinde anregt, das Stress-Hormon Cortisol auszuschütten“ (Spektrum.de, 1.8.1998). Frühtraumatisierte haben diesen Kreislauf schon früh vermehrt und sehr stark immer wieder erlebt, sodass er sich verfestigt. Schon geringe Gefahren werden von Frühtraumatisierten als große Gefahr „erkannt“. Doch das Wissen um diesen chronisch gewordenen Mechanismus kann ein Gefühl von Resignation und Hoffnungslosigkeit bei Ärzten, Psychotherapeuten und Patienten auslösen. Weiterlesen