



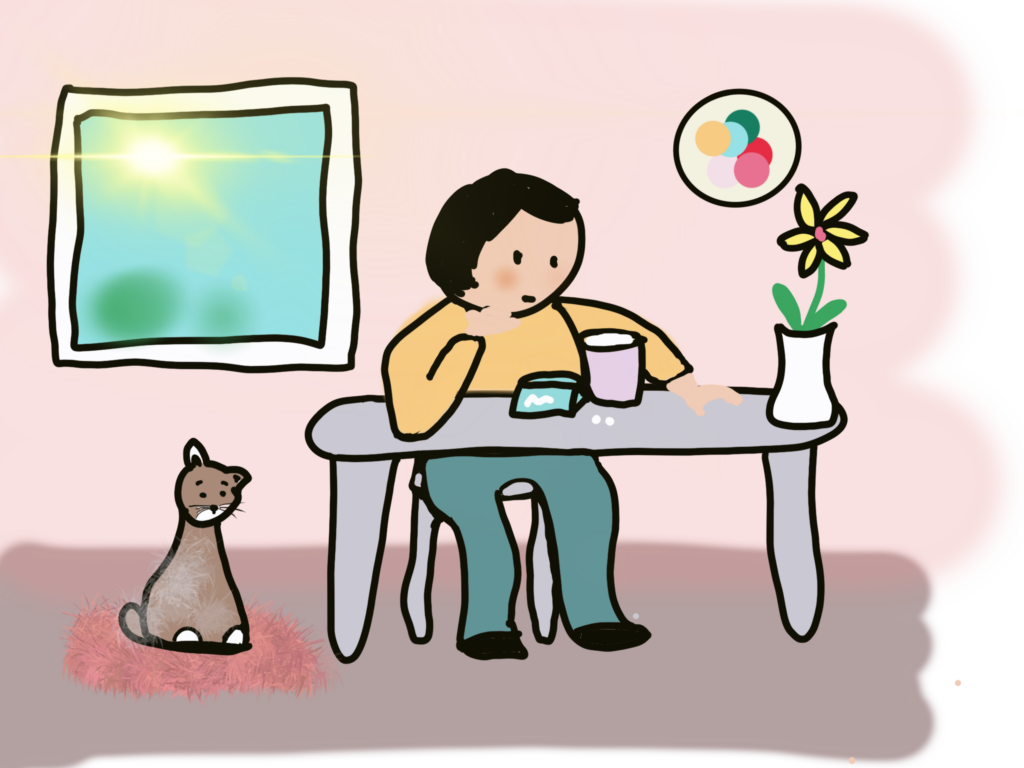
„Die Ärztin hat mir sofort Opipramol verschrieben – soll ich das nehmen?“, fragt mich die Patientin. Ich rate ihr, nach ihrem Gefühl zu gehen. Wenn Du in einem ähnlichen Dilemma steckst, ist es wichtig, über die Medikamentenfrage nachzudenken und dem zu folgen, was Dir selbst behagt. Vielleicht fühlst Du Dich vom Arzt zur Einnahme des Medikaments gedrängt, vielleicht bist Du ihm aber auch dankbar für die Verordnung. Oft hilft das Neue – die neue Idee, das neue Medikament. Doch sobald es älter und vertrauter wird, geht die anfängliche Erleichterung mitunter zurück.
Vielleicht hilft es Dir, über Zusammenhänge wie diese nachzudenken: Sobald Du ein Medikament nimmst, lenkst Du Deine Aufmerksamkeit darauf. Geht es Dir in den nächsten Tagen nicht gut, fragst Du Dich vielleicht, ob das Medikament das richtige ist und ob die Dosierung stimmt. Geht es Dir besser, denkst Du, das Medikament hat geholfen. Aber vielleicht gab es ganz andere Einflussfaktoren. Vielleicht hast Du selbst etwas gemacht oder bewirkt, so dass es dir besser geht.
Antidepressiva und Neuroleptika haben meistens gerade zu Beginn der Behandlung, aber auch beim Absetzen vielfältige Nebenwirkungen. Sie wirken auf das vegetative Nervensystem und auf die sexuellen Funktionen. Wenn du Antidepressiva nimmst, stellst du vielleicht fest, dass du nicht mehr so gut weinen kannst, obwohl du es gerne würdest. Vielleicht findest du es erleichternd, dass du nicht mehr so viel weinen musst, vielleicht aber empfindest du auch einen merkwürdigen Druck aufgrund der nicht heraus wollenden Tränen.
Vielleicht fühlst du dich von äußeren Einflüssen etwas ferner, was dir vielleicht gut tut. Andererseits spürst du möglicherweise aber auch, dass der Kontakt zu dir selbst und zu anderen nicht mehr so direkt ist. Vielleicht kannst du dich emotional nicht mehr so gut berühren lassen. Das kann entlastend sein, aber auch stören. Oft bewirken Antidepressiva auch einen Rückgang von sexueller Lust. Orgasmen können manchmal nicht mehr entstehen – viele Männer klagen auch über Erektionsstörungen durch Antidepressiva. Die Antidepressiva wirken also auf gewisse Art gegen die Tränen und gegen die Ejakulation gleichzeitig – da gibt es möglicherweise Zusammenhänge, die noch gar nicht richtig erforscht sind.
Bei vielen Medikamenten, z.B. bei Antidepressiva, diskutieren die Wissenschaftler noch über die genauen Wirkmechanismen und die möglichen Langzeitfolgen. Während oft vom Serotonin im Gehirn gesprochen wird, vergessen die meisten, dass die Serotonindepots im Darm riesig sind – viele Menschen, die Antidepressiva nehmen, leiden an Darmproblemen. Andererseits sagen manche, dass ihnen die Antidepressiva bei Reizdarm gut helfen.
Zwischen Psychiatern und Patienten können sich regelrechte Kämpfe entwickeln, wenn zum Beispiel der Psychiater Medikamente für richtig hält, der Patient aber diese Medikamente ablehnt.
Ähnlich, wie unerfahrene Ärzte aus Angst vielleicht öfter Antibiotika verschreiben, so können psychotherapeutisch unerfahrene Ärzte aus Unsicherheit rasch auf Psychopharmaka zurückgreifen. Erfahrenere Psychotherapeuten fühlen sich vielleicht öfter einfach als Mensch und Therapeut wirksam (Emotionale Präsenz als Wirkfaktor). Erfahrene und gut ausgebildete Psychotherapeuten wissen, dass die therapeutische Beziehung selbst enorm helfen kann, Probleme zu verstehen und auch extreme innere Spannungszustände zu lindern oder aufzulösen – vorausgesetzt, es findet eine regelmässige Therapie statt. Besonders Psychonalytiker haben oft erfahren, dass eine langfristige therapeutische Beziehung besser wirken kann als jedes Medikament. Das Problem ist allerdings, dass nur relativ wenige Menschen eine psychotherapeutische Beziehung in dem Ausmass erhalten, in dem sie sie benötigen würden. Medikamente sind eben oft auch ein Ersatz für ein fehlendes psychotherapeutisches Angebot.
„Nein“ zu einem Medikament zu sagen, obwohl der Arzt die Einnahme für richtig hielte, erfordert oft viel Mut. Ebenso kann es jedoch auch Mut erfordern, es einmal mit einem Medikament zu probieren.
Manche Ärzte haben jahrelange Erfahrung mit der Verordnung von Medikamenten – das kann viele Vorteile haben, denn sie haben ein gutes Gespür für die Medikamente entwickelt. Der Nachteil ist jedoch oft, dass sie gar nicht mehr wissen, wie psychische Störungen ganz ohne Medikamente verlaufen würden. Manche Ärzte und Psychotherapeuten nehmen selbst Antidepressiva ein und spüren, dass sie ihnen gut tun. Viele haben schon oft gesehen, wie es Patienten unter der Gabe von Medikamenten rasch besser ging. Sie haben erlebt, wie Patienten durch die kurzfristige Gabe schlaffördernder Medikamente regelrecht aufblühten. Viele Ärzte haben ein gutes Gespür dafür, welches Medikament zu welchem Patienten passt. Ärzte und Therapeuten, die hier unerfahren sind, sind vielleicht manchmal zu zurückhaltend mit der Verordnung von Medikamenten.
„Manchmal sind Medikamente notwendig, damit der Patient überhaupt fähig zur Therapie wird“, heisst es oft. Hier sollte meiner Meinung nach differenziert werden: Um welche psychische Erkrankung handelt es sich? Sprechen wir hier von drogenabhängigen Patienten, die aufgeregt sind? Wie „hoch oder niedrig strukturiert“ ist ein Patient? Wie sieht das Leiden und das soziale Leben der Betroffenen genau aus? Wie gut ist der Psychotherapeut ausgebildet und wieviel Erfahrung hat er?
Ich finde, es ist oft so: Patienten, die mit Medikamenten behandelt werden, finden erst dann einen befriedigenden Zugang zur Psychotherapie, wenn sie ihre Medikamente abgesetzt haben.
Medikamente können dazu führen, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit geschwächt wird. Während einer Psychotherapie wollen viele Patienten keine Medikamente nehmen, damit sie genau spüren, welche Wirkungen die Psychotherapie hervorruft. Ihre ungetrübte Gefühlswelt dient ihnen als wertvoller Kompass. Sie spüren deutlich, was ihnen gut tut und was ihren Zustand verschlechtert. Sie fühlen sich ohne Medikamente lebendiger, auch, wenn sie auf eine gewisse Art mehr leiden. Ihre Trauer, ihr Ärger, ihre Freude: das sind „sie selbst“.
Viele Patienten, denen es sehr schlecht geht, müssen oft lange auf einen Therapieplatz warten. Für Gespräche, Einfühlung und Trost bleibt oft keine Zeit. Manchmal werden dann Medikamente verschrieben, weil eben gerade „nichts Besseres“ da ist. Wichtig ist immer die Frage: Was möchte der/die Betroffene selbst?
Allein die Vorstellung: „Ich brauche ein Medikament“ kann das Selbstvertrauen reduzieren. Aber wer sagt denn, dass man ein Medikament „braucht“? Dass die Medikation „sein muss“? Viele gewinnen ihr Selbstvertrauen oft zurück, wenn ihnen jemand sagt: „Es geht auch ohne Medikamente.“ Die heilsame Beziehung zu einem Therapeuten ist oft wirksamer als jedes Medikament. Das zu erfahren, tut vielen sehr gut.
Anmerkung: In meiner psychotherapeutischen Praxis verordne ich keine Medikamente und empfehle Patienten, die ein Medikament nehmen möchten, zu einem Psychiater zu gehen. Ich persönlich glaube, auch bei schweren Depressionen, Schlafstörungen und Angststörungen ist es sinnvoller, keine Medikamente zu nehmen, wenn eine gute Psychotherapie oder Psychoanalyse zur Verfügung steht.
Die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen und medizinischen Fachgesellschaften (awmf.org) empfehlen in ihren Leitlinien die Kombination aus medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung, z.B. bei Depressionen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, sich ein eigenes Bild aus unterschiedlichen Quellen zu machen, und sich nicht allein auf die Leitlinien zu stützen. Leitlinien dienen der Orientierung, aber was sie sagen, ist kein Muss. Es ist wichtig, sich Therapeuten und Therapeutinnen zu suchen, denen man vertraut und dann eine Entscheidung zu treffen – auch wenn es der aufgebrachten Seele oft nur schwer möglich ist, sich zu entscheiden. Manchmal muss man sich auch zu einem Therapeuten „hinziehen“ lassen in der Hoffnung, dass man ihm vertrauen kann und dass es schon gut sein wird.
Die Compliance (= die „Mitarbeit“, man könnte auch der „Gehorsam“ sagen) der Patienten sei nicht gut, klagen viele Ärzte. Sie meinen damit, dass die Patienten nicht mitarbeiten. Das zeige sich zum Beispiel daran, dass zu viele Medikamente verschrieben und weggeworfen würden. Einerseits verschreiben Ärzte zu viel, andererseits erwarten wir als Patienten oft auch, dass der Arzt uns etwas verschreibt. „Der hat mir noch nicht mal was verschrieben!“, höre ich Patienten oft klagen.
Der Umgang mit den Medikamenten zeigt eines direkt und deutlich: Die Beziehung zwischen Arzt und Patient steht im Zentrum. Es wird stark unterschätzt, wie sehr ein Medikament auch ein „Beziehungsmittel“ zwischen Arzt und Patient ist. „Immer, wenn ich mein Medikament nehme, denke ich an meinen Arzt – schon allein das hilft mir“, denken wir vielleicht. Der Psychoanalytiker und Kinderarzt Donald Winnicott hat den schönen Ausdruck „Übergangsobjekt“ geprägt. Damit meinte er – sehr vereinfacht gesagt – zum Beispiel die Kuscheldecke oder den Teddy, die die Mama ersetzen, wenn sie nicht da ist. Was uns vom Arzt mitgegeben wurde, ist etwas, woran wir uns festhalten können. Wir können das Medikament sehen, fühlen und einnehmen. Wir nehmen mit dem Medikament immer auch ein bisschen den Arzt auf, der es uns verschrieben hat.
Besteht ein Vertraunsverhältnis zwischen Arzt und Patient, so wird das Medikament oft gerne genommen und es wirkt dann oft auch gut. In einer ehrlichen Beziehung traut sich der Patient jedoch häufig auch, offen „Nein“ zum Medikament zu sagen, anstatt es heimlich einfach nicht zu nehmen.
Vor einigen Jahren ergab die Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin eine Dysplasie am Muntermund. „Die nächste Stufe ist Krebs“, erklärte mir die Ärztin telefonisch und kurz angebunden an einem Freitag-Nachmittag. Das müsse flott operiert werden. Nach einem unruhigen Wochenende staunte ich dann über mich selbst, denn ich suchte am Montag einen Gynäkologen auf, der sich auf Homöopathie spezialisiert hatte. Die einstündige Fahrt machte mir nichts aus. In der Praxis im Grünen genoss ich die Ruhe und die wohltuende Atmosphäre. Nach einer Stunde Gespräch entschied sich der Frauenarzt für ein homöopathisches Mittel.
Wie ein kleines Heiligtum schleppte ich die Kügelchen mit mir nach Hause. Ich nahm sie alle paar Stunden sehr gewissenhaft ein und ging im Abstand von wenigen Wochen zu Kontrolluntersuchungen zum Frauenarzt. Ich denke, es war nicht der (nicht vorhandene) Wirkstoff des Medikaments, das mir half. Es war die gespürte Anwesenheit dieses Arztes alle paar Stunden, wenn ich diese Kügelchen nahm. Ich wusste übrigens immer, dass dieser Arzt sofort zu einer Operation geraten hätte, wenn er ein weiteres Abwarten wirklich nicht mehr hätte vertreten können. Zwei Jahre dauerte es, bis die Dysplasie auf einmal völlig verschwunden war.
Je kränker du bist, je mehr Sorgen du dir machst, desto größer ist die Bedeutsamkeit der Kügelchen, Tabletten oder Tropfen, die du vom Arzt bekommst und desto wichtiger ist auch die gute Beziehung zu Deinem Arzt oder Therapeuten. Dieses Zusammenspiel von Vertrauen, Glauben an ein Medikament und „echter Wirkung“ kann zur Genesung beitragen. Und manchmal ist es eben auch besonders hilfreich, ganz auf Medikamente zu verzichten und zusammen mit dem gewissenhaften Arzt zu beobachten und zu warten.
The International Society For Psychological And Social Approaches To Psychosis, ISPS:
Courtenay M. Harding, Biography
Harding erforschte das Leben von Menschen mit schwersten Psychosen über eine Zeitspanne von 30 Jahren und mehr.
http://www.isps.org/…
Joanna Moncrieff:
The Myth Of The Chemical Cure
Youtube
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 3.10.2012
Aktualisiert am 23.2.2025
VG-Wort Zählmarke 9223a51d73c344beab3ffbde0ba0704b
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Nach 8 Jahren Psychotherapie und Medikamenten-Einnahme habe ich mich dazu entschlossen, keine Medikamente mehr einzunehmen. Das Absetzen habe ich selber in die Hand genommen und viel zu schnell durchgezogen. Ich hatte aber keine Anleitung.
Angeblich gibt es ja keinen Entzug. Das kann ich so auf keinen Fall bestätigen. Auch zwei Monate später nicht. Meine Psychiaterin bestreitet dies. Ich fühle mich insgesamt freier, klarer, mehr Herr meiner Sinne, kann angemessener auf alles reagieren. Lasse mir nicht mehr alles gefallen, da ich nicht mehr sediert bin.
Die Depression ist noch da, ja. Aber sie war mit Medikamenten natürlich auch nicht weg. Meine Erfahrung ist, dass eine gute Gesprächstherapie durch nichts zu ersetzen ist. Rückblickend haben die Medikamente mein Leben sehr verändert. Und zwar zum negativen. Ich habe es nicht erkannt. Ein Wunder das ich mich überhaupt getraut habe, sie abzusetzen. Aber ich hab’s getan. Anstoß dafür war ein Mega-Arzt in der Klinik, in der ich nach 7,5 Jahren des Leidens war. Es geht mir nicht bedeutend besser! Aber ein wenig schon und ich habe diese schrecklichen Nebenwirkungen nicht mehr. Mal abgesehen von den oben erwähnten Dingen!
Ich denke, es kommt auch sehr darauf an, woran man genau leidet bzw. welche Tragweite das Problem hat, ob es nur punktuell ist oder universell bzw. chronisch.
Meine Meinung nach sehr vielen Jahren Erfahrung:
Ich bin inzwischen auch überzeugt, dass man eine wirklich voll ausgeprägte Depression niemals ohne Medikamente „behandeln“ kann. Vielleicht wäre „im Zaum halten“ auch der bessere Ausdruck. Echte Depressionen sind nun einmal nicht nur auf Lebensereignisse, sondern – und das zeigt die Forschung ja – auch auf gewisse genetische und biochemische Dispositionen zurückzuführen. Das heißt, dass man eventuell vielleicht gar nicht depressiv reagieren würde, gäbe es die Veranlagung nicht. Das leuchtet mir irgendwie schon ein. Echte Depressionen (ich spreche nicht von Verstimmungen) haben in den meisten Fällen auch die Tendenz zur Chronifizierung, so dass es in diesen oft genug doch überhaupt nicht mehr darum geht, irgendeine Heilung zu initiieren, sondern einfach nur darum, einigermaßen erträglich leben zu können. Und ich bin heilfroh, dass es Medikamente gibt, denn die Wirkung von Psychotherapie ist in vielen Fällen einfach nicht vorhanden bzw. zu minimal ausgeprägt. Das ist leider auch das, was mir viele Leidensgenossen über die Jahre erzählt haben. Deshalb plädiere ich dafür, gut zu unterscheiden, um welche Problematik es geht.
Dass man in unserer Gesellschaft insgesamt aber zu viele Medikamente verschreibt (ich bin gerade in Bezug auf Ritalin oft schockiert), finde ich auch und ist ja ebenfalls durch Zahlen belegt. Die Frage ist oft doch: Wollen wir eine Pille, die uns jedes Problem wegzaubert? Oder geht es darum, einem Menschen, der erkrankt ist, zu helfen.
Als Betroffene habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, wie in meinem Fall Antidepressiva, wieder abzusetzen. Trotz Ausschleichen litt ich unter Absetzsymptomen, die sogleich als Wiederauftreten der Erkrankung diagnostiziert wurden. Dank meiner zuversichtlichen Therapeutin und meinem stabilen sozialen Umfeld und natürlich meinem unermüdlichen, wiedererwachten Kampfgeist, habe ich im zweiten Anlauf mein Ziel ohne Psychopharmaka-Dauereinnahme zu leben, nun fast erreicht. Es ist schade und unverständlich, dass offenbar kaum ein Facharzt auf die Idee kommt, dass nicht eine weitere Aufdosierung oder Medikamentenumstellung, sondern im Gegenteil deren möglichst baldiges, sehr vorsichtiges Absetzen der letztlich heilsame Schritt ist. Nur so gelangt der Mensch doch erst wieder zum Glauben an seine eigene innere Kraft und Stärke!
Medikamente können helfen, besonders wenn es ganz schlimm ist, aber sie könne auch zum Problem werden. Ziel muss es ja sein, das der Patient selbst Verantwortung über nimmt und lernt mit seiner Psyche wieder selbst zurecht kommt. Gibt der Patient diese Verantwortung ganz oder teilweise an Medikamente (oder den Therapeuten) ab, so wird er immer weiter darauf bauen, das Tabletten (und der Therapeut) ihm hilft. Das mag zwar in einer akuten Situation angezeigt sein, aber Ziel muss es ja sein, wieder so weit wie möglich in ein selbständiges Leben zurück zu kehren. Wichtiger als schnell Medikamente zu verschreiben wäre mit dem Patienten zusammen einen geeigneten Therapieplan aufzustellen und für Rückfragen zu Verfügung zu stehen, aber das ist nicht immer gegeben.
Hatte ein paar Jahre als Laienhelfer in der Psychiatrie Haar bei München gearbeitet. Medikamente eröffneten meist überhaupt erst die Möglichkeit, daß ein Psychiater eine therapeutische Gesprächsbeziehung mit einem Patienten beginnen konnte,
Vieles geht auch ohne Medikamente. Mag sein das es länger dauert um aus einem Tal wieder raus zu kommen, aber es ist möglich! Mit Medikamente fühlt sich das Leben „furchtbar“ fremdgesteuert an. Es bedarf nicht nur guter Therapeuten, sondern auch beste Freunde, die IMMER für einen da sind.
Ein sehr schwieriges Thema, bei dem man von Fall zu Fall anders entscheiden kann. Ich bin allerdings dafür, dass Psychopharmaka wie Antidepressiva nur eingesetzt werden sollen, wenn die Patienten auch zu wissen bekommen, welche erheblichen Nebenwirkungen eintreten -können-. Ich glaube, dass genau an dieser Stelle oftmals die Beratung zu kurz kommt.